Regenbogenfamilie – Kindererziehung im Co-Parenting
Regenbogenfamilie ist eine Bezeichnung für Eltern, die gleichgeschlechtig sind und in ihrem Haushalt Kinder erziehen. Aus dieser Form des Familienlebens erwachsen neue Strukturen, die noch nicht jedem bekannt sind. Das Co-Parenting ist eine der neuen Formen, die sich in der Gesellschaft zunehmend etabliert. Der rbb hat in seiner Serie „Ich zeig dir meine Welt“ ein lesbisches Paar vorgestellt, das für sich die Erziehungsform des Co-Parenting gewählt hat. Ich habe mir den Beitrag angeschaut und die Kommentare im Netz gelesen. Die Frage, die ich mir stelle, lautet: Wohin entwickelt sich das Modell Familie und welche Zukunft hat Ehe zwischen Mann und Frau, die einst für ein Leben geschlossen wurde?

Ich zeig dir meine Welt – eine Serie des rbb
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg stellt in seiner Wochenserie „Ich zeig dir meine Welt“ Menschen in ihrem Alltagsleben vor. In der Rubrik möchte der Sender nach eigenen Angaben „Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten treffen, die für uns ihre Augen öffnen und sagen: Ich zeig dir meine Welt.“
Am 26. April 2025, erzählen Paula, Kristine und Stefan von ihrer Familienstruktur. Die jungen Frauen sind miteinander verheiratet. Sie haben zwei Kinder von Stefan: Ihn lernten sie über Familychip kennen. Über das Portal vernetzen sich Menschen mit Kinderwunsch, die keine klassische Partnerschaft anstreben. So ist es auch in der vorgestellten Familie: Das Sorgerecht für die Kinder haben Paula und Kristine. Stefan zahlt keinen Unterhalt. Er sieht seine Kinder regelmäßig, ist dabei aber auf das Wohlwollen der Mütter angewiesen. Das Video kannst du unter diesem Link abrufen. Der Zeitraum ist jedoch begrenzt: Beim Aufruf älterer Beiträge kommt eine Fehlermeldung.
Jeder darf seine Geschichte mitteilen
Auf der Seite des rbb-Projekts ist jeder aufgerufen, seine individuelle Geschichte mitzuteilen. Mir fehlen in der Rubrik Geschichten von Paaren, die sich für ein klassisches Leben entschieden haben. Darf ich das noch so bezeichnen? Ich meine die Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Beide bekommen Kinder und ziehen sie groß: Entweder gemeinsam oder im Patchwork. Bewerben sich Paare aus Lebensmodellen abseits des Regenbogens nicht oder werden sie nicht berücksichtigt? Ich kann mich an einen Beitrag über einen jungen Potsdamer Studenten erinnern, der non-binär ist. In einer weiteren aktuellen Folge wird ein Geschwisterpaar vorgestellt, das ohne seine Eltern lebt: Sie sind ausgewandert.
Ich habe noch keinen Beitrag über eine klassische Familienstruktur gelesen oder gesehen. Vielleicht habe ich es verpasst, vielleicht ist die Serie zu neu oder es gibt keinen. Schade ist, dass ältere Beiträge nicht mehr abgerufen werden können. Sonst wäre es möglich, sich einen Überblick über die Inhalt der durchaus interessanten Reihe zu verschaffen.
Auf Nachfrage betonte der rbb, offen für jegliche Lebensformen zu sein und diese auch zu berücksichtigen. Weiterhin wird in der Facebook-Kommentarspalte für einen „regen Austausch“ geworben. Wer das Regenbogenmodell verurteilt, wird vom rbb zurechtgewiesen. Richtet sich der Kommentar gegen die klassische Familie, bleibt das vom Sender unkommentiert.
Co-Parenting: Was versteht man darunter?
Beim Co-Parenting erziehen Eltern ein Kind miteinander, ohne dass sie dabei eine Partnerschaft eingehen. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die Eltern eine gezielte Bindung miteinander eingehen. Diese Form der Kindererziehung ist bei homosexuellen Paaren weit verbreitet: Auch Paula und Kristine hatten den Wunsch, dass ihre Kinder den Vater kennenlernen. Es gibt aber auch heterosexuelle Eltern, die ein Kind zeugen, ohne eine Partnerschaft zu wünschen, und das Kind in einer Form des Co-Parentings betreuen und erziehen.
Die rechtliche Seite ist eindeutig definiert
Wir alle dürfen in unserem Land so leben, wie wir es möchten. Dies bedeutet, dass es kein Problem ist, in einer Dreierkonstellation ein Kind zu erziehen. Rechtlich betrachtet, sind die Freiheiten nicht so groß: Das Sorgerecht dürfen nur zwei Elternteile haben. Paula und Kristine haben in der vorgestellten Konstellation des Co-Parentings das gemeinsame Sorgerecht für sich beansprucht. Stefan war damit einverstanden. Das ältere zweijährige Kind sagt „Papa“ zu ihm und darf ihn einmal in der Woche besuchen. Das jüngere Kind ist noch ein Baby. Im Film trägt es Stefan bei einem Spaziergang in einem Tragetuch.
Vater ohne Recht und Pflicht
Ihm ist bewusst, dass er an seinen Kindern keinerlei Rechte hat. Darauf angesprochen, erwähnt er „eine gewisse Naivität“, die erforderlich wäre, um ein solches Modell zu leben. Warum er kein klassischer Papa sein wollte, thematisiert Stefan nicht. Er sagt nur, dass er mehr sein wollte, als ein Onkel oder ein Samenspender. Er hätte sich immer eine aktive Vaterrolle gewünscht.
In der Theorie können Paula und Kristine dem leiblichen Vater jederzeit das Besuchsrecht verweigern. Abgesehen davon hat Stefan aber auch keine Pflichten. Für den Unterhalt der Kinder kommen die Mütter auf. Sie bestimmen auch, auf welche die Schule die Kinder gehen werden und ob erforderliche medizinische Behandlungen durchgeführt werden. Stefan bleibt die Rolle des Besuchspapas, solange sich die drei Eltern gut verstehen. Paula erwähnt, dass Stefan beim Notar die erforderlichen Dokumente unterschrieben hätte. Welche das waren, erklärt sie nicht.
Die Kinder wachsen ganz natürlich mit drei Eltern auf
Ich glaube, dieser Satz ist es, der mich neben einigen Kommentaren und der – nicht vorhandenen – Reaktion des rbb dazu bewogen hat, diesen Artikel zu schreiben. Ist es mittlerweile ganz natürlich, mit drei Eltern aufzuwachsen? Es betrifft ja nicht nur die vorgestellte Regenbogenfamilie: Viele Kinder aus heterosexuellen Partnerschaften haben mehrere Eltern, weil sie in einer Patchworkfamilie leben. Und doch sind die Linien in diesen Familien klarer definiert: Es gibt eine leibliche Mutter und einen leiblichen Vater. Und es gibt den Partner oder die Partnerin.
Die beiden Kinder von Paula und Kristine haben zwei Mütter. Ob sie je erfahren, von welcher Mama sie abstammen, wurde in dem kleinen Film nicht thematisiert. Ich bin eher konservativ eingestellt: In meiner Lebenswelt gibt es natürlich verschiedene Formen des Zusammenlebens. Aber unabhängig davon kann kein Mensch drei Eltern haben. Es gibt biologische Vorgänge, die auch postmoderne Lebensformen wie das Co-Parenting nicht aushebeln können.
Biologische Vorgänge können wir – noch – nicht ändern
Wir alle entstehen aus einer weiblichen Eizelle und einer männlichen Samenzelle. Dies trifft auch auf die Kinder von Paula und Christine zu. Somit haben beide eine einzige Mutter und einen einzigen Vater. Sie mögen mit drei Eltern aufwachsen, aber „ganz natürlich“ ist es nicht. Es ist eine von vielen neuen Lebensformen, von denen Paula fordert, dass sie einfach nur normal sind. Ich frage mich: Sind sie das nicht längst? Oder wären sie es, wenn es einfach gelebt und nicht ständig überthematisiert würde?
Kontakte zu anderen Regenbogenfamilien
Im Bericht erzählt Kristine, dass die Familie Kontakt zu anderen Regenbogenfamilien in unterschiedlichen Konstellationen unterhält. Das wäre notwendig, damit die Kinder lernen, dass sie in einem normalen Elternhaus aufwachsen. Lernen die Kinder auch die klassische Mama-Papa-Kind-Strukur kennen oder kommt das Modell in der Welt von Paula und Kristine nicht vor? Sollten sie nicht gezielt Bindungen zu klassischen Familien aufbauen, um ihren Kindern auch dieses Lebensmodell nahe zu bringen?
Haben Stefans Eltern Kontakt zu den Kindern? Schließlich sind sie die leiblichen Großeltern. Diese Fragen stelle ich mir als Mutter von erwachsenen Söhnen. Hypothetisch, denn unsere Kinder haben sich für das klassische Lebensmodell entschieden.
Ich habe mir den Bericht zu Ende angeschaut. Er gibt keine Antworten auf die Frage, wie die drei Eltern ihren Kindern vermitteln möchten, dass es Familien gibt, in denen Mann und Frau eine Liebesbeziehung zueinander unterhalten und Kinder mit einer männlichen Bezugsperson im Haushalt aufwachsen, unabhängig davon, ob es der leibliche Vater ist oder der Partner der Mutter. Darin liegt meine Kritik: Jeder soll leben, wie er möchte, das tue ich auch. Aber ich setze mich mit allen möglichen Lebensformen auseinander. In der Regenbogenwelt, so scheint es, sind die Menschen gern unter sich. Paula und Kristine bestätigen diese Vermutung in dem Beitrag.
Meinungen zum klassischen Familienmodell
Das klassische Familienmodel existiert in einigen Köpfen gar nicht mehr oder es wird stark verunglimpft, wie es einige Kommentare auf Facebook zeigen.
Hauptsache den Kindern geht es gut. In viel zu vielen „klassischen“ Familien werden Kinder misshandelt sowohl physisch wie psychisch.
Yvonne Heise auf Facebook
Natürlich darf jeder eine eigene Meinung haben, aber dieser Kommentar hat mich nachdenklich gemacht. Woher kommt die Ansicht, dass in „vielen“ klassischen Familien die Kinder physisch und psychisch misshandelt werden? Kritisieren möchte ich in diesem Zusammenhang den rbb: Von den Moderatoren hat niemand eingegriffen.
Die Kinder dieser Generation werden als Jugendliche und Erwachsene alle einen an der Waffel haben. 2 Väter, 3 Mütter, Mütter mit Dödel, Väter mit Brüsten und kleinen Zöpfchen (tatsächlich neulich gesehen) Fehlt noch der Bruder als Mutter und die Schwester als Mutter. Wenn da nicht Kinder ungefragt involviert wären wärs mir egal, wer was treibt, aber das ist eine Entwicklung, die ich persönlich für ungesund halte.
Evi Steffen auf Facebook
Bei diesem Kommentar griff der rbb ein.
In deinem Kommentar verunglimpfst du das gezeigte Familienmodell und vergleichst eine scheinbar glückliche Familie, mit kruden Paarbeziehungen in Form von „Bruder als Mutter“ – dies hat nichts mehr mit respektvollem Meinungsaustausch zu tun.
Antwort des rbb auf den Kommentar von Evi Steffen
Mir stellte sich die Frage, ob es sich bei dem ersten Kommentar um einen „respektvollen Meinungsaustausch“ handelt. Für mich stellt es sich so dar, dass die respektlose Meinung gegen die klassische Familie durchgeht, während eine – ohne Zweifel – ebenso resprektlose Aussage gegenüber den alternativen Lebensformen die Moderatoren auf den Plan ruft.
Kinder brauchen Liebe
Viele Meinungen gehen in die Richtung, dass es für das Glück eines Kindes keine Rolle spielt, in welcher Familie sie aufwachsen. Wichtig ist, dass sie geordnete Strukturen und Liebe bekommen. In dem Video vermittelt das Elterntrio ohne Zweifel den Eindruck, dass es sich um die Entwicklung der Kinder viele Gedanken macht. Wobei ich nicht unbedingt ein Freund von „Elterngesprächen“ bin, bei denen drei Erwachsene miteinander eruieren, wann das Kind den Vater besuchen darf.
Vermutlich geht es auch darum, was für das Kind das Beste ist. In meiner Erfahrung ergibt sich das eher aus der Situation, als aus Gesprächen unter Erwachsenen. In der vorgestellten Familie lebt eine Klimawissenschaftlerin mit einer Sozialarbeiterin zusammen. Als Vater wurde via Familychip ein Architekt gewählt. Eltern mit hoher Bildung streben häufig eine Perfektion an, die gar nicht notwendig ist, Denn Kinder brauchen in erster Linie Zeit, Liebe und Wurzeln.
Jedes Kind wird einmal erwachsen
Nun ist es ja so, dass jedes Kind eines Tages seinen 18. Geburtstag feiert. Es ist volljährig, geht noch zur Schule oder hat sie abgeschlossen. Es möchte studieren oder eine Ausbildung beginnen. Auf welche Kindheit blickt es zurück? Wie sind Freunde und Schulkameraden damit umgegangen, dass die Kinder mit zwei Müttern aufwuchsen? Haben Kinder aus konservativen Elternhäusern dumme Bemerkungen gemacht? Gibt es Stefan immer noch, als väterliche Bezugsperson, und haben Paula und Kristine die Stürme überstanden, die jede längere Beziehung durchstehen muss? Schließlich ist es heute eher normal, in seinem Leben mehrere Partner zu haben, als eine Langzeitbeziehung mit nur einem Partner zu führen.
Haben die Kinder das klassische Familienleben mit Papa und Mama vermisst? Und wie werden sie selbst leben, wenn sie im Freundeskreis ihrer Eltern nur das Regenbogenmodell kennen, weil Paula und Kristine sich entschieden hatten, ihren Kindern auf diesem Wege Normalität zu bieten? Was sagen Studien zu den alternativen Lebensmodellen?
Co-Parenting vs. Tradition – ein kleiner Blick in die Wissenschaft
In den aktuellen Debatten rund um neue Familienmodelle wird häufig betont, dass die Struktur der Familie für das Kindeswohl weniger entscheidend sei, als die Qualität der Beziehungen innerhalb des Systems. Michael Lamb (2012) unterstreicht, dass stabile und liebevolle Bindungen das Fundament einer gesunden Entwicklung bilden – unabhängig davon, ob Kinder in klassischen Familien, Patchwork-Konstellationen oder Co-Parenting-Modellen aufwachsen.
Dennoch zeigen Langzeitstudien wie die von Judith Wallerstein (2000), dass Kinder aus instabilen oder fragmentierten Familiensituationen langfristig ein erhöhtes Risiko für emotionale Unsicherheiten und Bindungsschwierigkeiten tragen. Auch Elizabeth Marquardt (2005) weist darauf hin, dass Kinder in nicht-traditionellen Familienformen häufiger innere Loyalitätskonflikte erleben, was ihre Identitätsentwicklung beeinträchtigen kann. Diese Befunde legen nahe, dass gerade alternative Familienmodelle besondere Anforderungen an die Eltern stellen, um emotionale Stabilität aktiv und bewusst zu gestalten.
In gewissem Sinne geben die Studien Kritikern der neuen Lebensmodelle recht. Aber vielleicht schaffen es Paula und Kristine, ihre Kinder zu jungen Menschen zu formen, die sich offen in der Gesellschaft bewegen und sich nicht mit inneren Konflikten und emotionalen Unsicherheiten auseinandersetzen müssen.
Die Ansicht einer konservativen Familie
Wir leben ein sehr konservatives Familienmodell in einer Langzeitbeziehung mit gemeinsamen Kindern, die wir offenbar ebenso konservativ erzogen haben. Bei uns gab es keine Elterngespräche am Küchentisch, wir waren bei den Geburten unserer Kinder viel zu jung, um irgendwas zu reflektieren. Unsere Erziehung erfolgte aus dem Bauch heraus, ohne pädagogische Ansätze, aber mit viel eigener Initivative. So habe ich meinen Beruf zurückgestellt, weil ich meine Kinder nicht morgens um sechs Uhr in der Krippe abgeben und die Entwicklung selbst mitverfolgen wollte. Mein Mann arbeitet im Schichtdienst, wir wollten eine Familie sein und uns nicht die Klinke in die Hand geben.
Mein Mann ist mit einem autoritären Stiefvater aufgewachsen, und er war mehr als 30 Jahre mit einem ehemaligen Klassenkameraden befreundet, der schwul ist. Somit lernten unsere Kinder früh, dass es andere Lebensmodelle gibt. Und auch bei uns gab es Pubertätsstress und ein paar Anläufe, bis der Lebensweg gefunden wurde. Dennoch haben sie eine gewisse konservative Haltung bewahrt: Sie sind offen anderen Lebensformen gegenüber, zeigen sich aber genervt von der Überpräsens des Regenbogens. Ein Modell wie Stefan würden sie nicht leben wollen, sie setzen auf die Struktur, die sie in unserer Familie kennengelernt haben, und führen klassische Partnerschaften.
Paula und Kristine suchen Regenbogenfamilien in ihrem Umfeld, wir waren mit Ausnahme des Schulfreundes immer mit klassischen Familien befreundet. Ich muss aber sagen, dass es in unserer Kleinstadt vor 20 Jahren gar keine anderen Strukturen gab. In die Klasse unseres Enkelkindes geht ein Kind mit zwei Müttern. Es ist bekannt, aber kein Thema. Ich glaube, das wäre in unserer Zeit ähnlich gewesen.
Bitte die traditionelle Familienstruktur nicht vergessen
In vielen Diskussionen, auch unter dem Post des Co-Parenting-Modells von Paula, Kristine und Stefan, geht es fast ausschließlich um Formen der Elternschaft, die vom klassischen Modell abweichen. Es wird Akzeptanz und Offenheit gefordert. Dabei gerät meiner Meinung nach die Familienstruktur, in der Elternteile unterschiedlichen Geschlechts in einer dauerhaften Partnerschaft miteinander leben, in den Hintergrund. Das sollte sich wieder ändern.
In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Familienmodellen sollten klassische Partnerschaften wieder gleichwertig angesehen und berücksichtigt werden. Gehören wir, die wir uns dafür entschieden haben, nicht zur Vielfalt, für die überall Toleranz gefordert wird? Wenn wir bestrebt sind, die Vielfalt familiärer Lebensrealitäten abzubilden, sollten wir die Bedeutung klassischer Lebensformen vielleicht nicht ganz aus dem Blick verlieren.
Vielleicht stellt der rbb in einer seiner nächsten Storys einmal ein Modell vor, in dem ein heterosexuelles Paar sich als Teenager kennenlernte und eine Langzeitbeziehung führt. Oder in dem die Probleme alleinerziehender Mütter thematisiert werden, die sich gewünscht hätten, mit dem Vater ihres Kindes in einer glücklichen Beziehung zu leben. Es gibt so viele Patchworkfamilien, die von einer glücklichen oder komplizierte Lebensrealität erzählen können. Und es gibt junge Menschen, die ihren Partner fürs Leben noch nicht gefunden und ganz eigene Ängste und Sorgen haben.
Hat das klassische Familienmodell eine Zukunft?
Gehen wir zurück in die Zeit unserer Eltern und Großeltern: In unserer lokalen Zeitung wird immer wieder über Paare berichtet, die 60 oder 70 Jahre miteinander verheiratet sind. Die Fotos sind sehr rührend, die Geschichte ihres Lebens auch. Da wird von gegenseitiger Toleranz gesprochen, von der Gabe, verzeihen zu können, und davon, dass wir nie ins Bett gehen sollten, ohne uns miteinander zu versöhnen.
In unserer Lebenswelt sind diese Langzeitbeziehungen selten geworden. Nicht zuletzt resultieren daraus Lebensformen wie Patchwork oder Co-Parenting. Doch warum gibt es die Langzeitbeziehungen nicht mehr, und welche Zukunft hat dieses Modell? Warum wollen Paare heute nicht mehr verzeihen, Fehler des anderen tolerieren und sich nach einem Streit versöhnen? Ist ein Leben mit verschiedenen Partnerschaften wirklich ausgefüllter? Oder eines, wie es Paula und Kristine beschreiben?
Ich glaube an die Zukunft der Verbindung zwischen Mann und Frau. Egal, wie man es definieren möchte: Ohne sie geht es nicht. Und so werden auch künftig Kinder in klassischen Lebensformen aufwachsen. Doch wird es, so wie heute, die Mehrheit sein?
Wie stehst du dazu? Vermisst du Geschichten über klassische Lebensformen oder findest du es gut, dass wir mehr über Co-Parenting und andere alternative Beziehungsmodelle erfahren? Schreib es gern in die Kommentare.
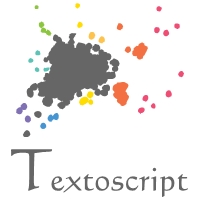
Beitragsbild © A_Naranjo | pixabay





