Marodes Gesundheitssystem: Gebühren vs. Versorgung
Unser marodes Gesundheitssystem krankt, eine Umkehr ist nicht in Sicht. Das Land Brandenburg kündigte an, dass Patienten Einsätze mit dem Rettungswagen selbst bezahlen sollen. Erste Rechnungen wurden umgehend verschickt. Mehrere Landkreise sind betroffen, die Kosten liegen im dreistelligen Bereich. Gesetzlich versicherte Patienten warten monatelang auf einen Termin beim Facharzt und sitzen dann stundenlang im Wartezimmer. Eine neue Gebühr soll all jene treffen, die ihre Termine nicht rechtzeitig absagen. Der Wechsel eines Hausarztes ist nur für Zugezogene möglich. Die arbeitende Bevölkerung zahlt Kassenbeiträge für die Bürgergeldempfänger. In den Krankenhäusern warten Krebspatienten, bis eine Fachkraft die Chemo abklemmt. Was ist los, mit Deutschlands ärztlicher Versorgung?

Gesundheit 2025 – Eine Bestandsaufnahme
Für gesetzlich versicherte Patienten war das erste Quartal des Jahres 2025 alles andere als befriedigend: Es begann mit Beitragserhöhungen, die dafür sorgten, dass die meisten Menschen trotz angehobenem Steuerfreibetrag in der Januarabrechnung weniger Geld zur Verfügung hatten. Unsere lokalen Nachrichten in Brandenburg berichten von Zuzahlungen in dreistelliger Höhe für die Alarmierung des Rettungsdienstes. Erste Rechnungen wurden umgehend verschickt. Auch rückwirkend. Dann hieß es plötzlich, die Patienten müssen erst einmal nicht zahlen.
Die kassenärztliche Vereinigung brachte den Vorstoß, dass Patienten für nicht abgesagte Termine eine Gebühr von bis zu 100 EUR zahlen müssen. Was auf den ersten Blick vernünftig klingt, ist auf den zweiten sehr fraglich. Denn nicht nur ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Arztpraxen telefonisch nur sehr schwer zu erreichen sind.
Dann könnten wir noch über die ärztliche Versorgung sprechen. Sie ist vor allem in den Krankenhäusern sehr schlecht. Fachärzte haben keine Zeit für ihre Patienten. Hausärzte, die sich Zeit nehmen, haben übervolle Wartezimmer und nehmen keine neuen Patienten an. Schauen wir uns die Punkte doch einmal im Detail an.
Massive Beitragserhöhungen für gesetzlich Versicherte
Zu Beginn des Jahres 2025 erhöhten die Krankenkassen den Zusatzbeitrag massiv. Nicht wenige zeigten die zweite Beitragserhöhung in Folge an. Gleichzeitig erhöhte die Regierung den steuerlichen Grundfreibetrag um etwa 350 EUR im Jahr, um die Bürger zu entlasten. Diese „Entlastung“ floss direkt zur Krankenkasse und viele Arbeitnehmer zahlen sogar noch drauf. Woran liegt es, dass die Krankenkassen so knapp bei Kasse sind?
Regierung zahlt nur geringe Sozialbeiträge
Die Krankenversicherung ist mit den Bürgergeldempfängern und Migranten belastet: Beide Gruppen bekommen in Deutschland eine kostenlose Krankenversorgung. Eigentlich ist die Bundesregierung verpflichtet, die Krankenkassenbeiträge für die kostenlos versorgten Bürger zu zahlen. Doch die Pauschale von 119,60 EUR pro Kopf ist nicht ausreichend, um die tatsächlichen Kosten zu decken. So entsteht in jedem Jahr ein Defizit von 10 Milliarden Euro, das die Krankenkassen bei der Regierung angemahnt haben.
Bekommen haben die Kassen das Geld nicht. Im Juni 2024 gaben Bundeskanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach bekannt, dass „angesichts der angespannten Haushaltslage und der Vorgaben der Schuldenbremse“ keine höheren Einzahlungen an die Krankenkassen möglich wären. Nun zahlen die Bürger die Differenz aus ihrem eigenen Portemonnaie.
Wechsel der Krankenkasse?
Der Wechsel der Krankenkasse bringt nur eine geringe Ersparnis ein: Wir wechselten im Jahre 2024 in eine günstigere Kasse. Dieser erhöhte dann die Beiträge im Jahre 2025 so massiv, dass wir in unsere alte Kasse zurückwechselten. Ja, wir haben in dem knappen Jahr ein wenig Geld gespart. Für Menschen, die selten krank sind, ist das ein guter Weg. Wer Kinder und mitversicherte Ehepartner hat, stemmt einen größeren bürokratischen Aufwand.
Noch schwieriger ist der Wechsel während einer Krankheit: Bei uns war ein wochenlanger Ausfall des Krankengeldes die Folge, weil erst sämtliche Werte neu eingeholt werden mussten. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse werden teurer, ohne dass die Leistung besser wird. Im Gegenteil: In Zukunft könnten weitere Kosten auf die gesetzlich Krankenversicherten zukommen.
Zuzahlungen für medizinische Leistungen
Ja, wir hatten einmal eine sehr günstige Rundumverxorgung, aber das ist sehr lange her. Wer sich noch an die 1990er-Jahre erinnern kann, stimmt mir sicher zu: Die Gesundheitsversorgung war mit den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenkasse nahezu abgedeckt. Doch dann begannen die ersten Löcher zu klaffen: Sie wurden gestopft, indem die Versicherten mehr bezahlen mussten.
Heute leisten wir über den Zusatzbeitrag hinaus etliche Zuzahlungen. Einige Beispiele, die es so vor 30 Jahren noch nicht gab:
- Zuzahlung zu rezeptpflichtigen Medikamenten
- IGEL-Leistungen (Du musst sie allein zahlen, wenn sie nicht medizinisch notwendig sind. Dazu zählen auch Vorsorgeuntersuchungen)
- Beim Zahnarzt bekommst du nur noch eine Schmerzbehandlung. Selbst einfache Prothesen sind mit einer Zuzahlung belegt. Eine moderne Versorgung, etwa mit Implantaten, zahlst du aus eigener Tasche
- Krankenhausaufenthalte kosten 10 EUR pro Tag, weil du dich zu Hause nicht selbst verpflegen musst. Wenn du die Mahlzeiten aufgrund ihrer schlechten Qualität ablehnst und dich selbst versorgst oder versorgen lässt, wird die Gebühr dennoch fällig
- Zuzahlungen zu Heilbehandlungen wie Physiotherapie sind Pflicht
- Einige Medikamente, etwa gegen Erkältungen, musst du komplett selbst zahlen
Nun könnte ein weiterer Posten hinzukommen: Das Land Brandenburg möchte Patienten an den Kosten für die Rettungsdienste beteiligen. Zunächst sollte die Regelung rückwirkend zum Jahresanfang 2025 in Kraft treten. Nun wurde der Start verschoben.
Den Rettungswagen selbst zahlen
Die Nachricht verunsicherte viele Patienten im Land Brandenburg: Die Krankenkassen weigern sich, die hohen Kosten für die Rettungsdienste zu zahlen. Die Patienten sollen für einen Rettungseinsatz einen Anteil in dreistelliger Höhe selbst bezahlen. Grund: Die Landkreise, die für die Kalkulation zuständig sind, rechnen falsch und überweisen zu wenig Geld an die Krankenkassen.
Die Meldungen überschlugen sich in wenigen Tagen: Während die ersten Patienten rückwirkend zum 1. Januar 2025 Rechnungen bekamen, sollte die Vorgabe gar nicht in allen Landkreisen gelten. Einige, unter ihnen Potsdam-Mittelmark, gaben an, die Kosten übernehmen zu wollen. Dann gab es eine Kehrwende: Nun brauchen die Bürger doch nicht zahlen.
Wenn der Patient den Notfall erkennen muss
Im Zusammenhang mit der Berichterstattung taten sich verschiedene Fragen auf: Was ist, wenn eine fremde Person den Rettungsdienst ruft, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre? Wenn der Patient das gar nicht wollte.
Was ist mit lebensnotwendigen Einsätzen? Bekommen die Patienten auch eine Rechnung? Wer entscheidet über die Notwendigkeit? Leerfahrten sollen vermieden werden, das ist verständlich. Doch kann ein Laie erkennen, ob sich ein Mensch in einer Notlage befindet oder nicht?
Wenn eine solche Regelung in Brandenburg oder in einem anderen deutschen Bundesland umgesetzt würde, wäre das ein weiterer Tiefpunkt in der medizinischen Versorgung. Dabei gibt es doch schon genug andere.
Beispiele aus dem Alltag in der medizinischen Versorgung
In der Familie und im Freundeskreis erlebe ich immer wieder, dass die medizinische Versorgung stark zu wünschen übrig lässt. Natürlich können die Praxen und Krankenhäuser nichts dafür, dass es überall an Personal fehlt. Doch dass die Patienten, die immer mehr für die Versorgung zahlen müssen, die Leidtragenden sind, ist auch keine Lösung. Die Politik müsste eingreifen. Doch darauf warten Betroffene seit Jahren.
Die Wartezeit auf einen Facharzttermin
Kürzlich wartete ich knapp vier Monate auf einen Termin beim Facharzt: In meinem Ort gibt es einen, der keine neuen Patienten aufnimmt. Also versuchte ich es in einer 15 Kilometer entfernten Praxis. Ich hatte einen Überweisungsschein von meinem Hausarzt und nutzte die Terminvereinbarung per Mail. Als Antwort bekam ich von einer Schwester, dass die Fachrichtung nicht zuständig wäre. Erst nachdem ich darauf hinwies, dass mein Hausarzt die Fachrichtung bestimmt und nicht die Schwester oder ich, bekam ich den Termin mit genannter Wartezeit.
Vor Ort saß ich zwei Stunden im Wartezimmer. Ich war lange nach der Schließzeit der Praxis die letzte Patientin, obwohl ich nicht als Letztes gekommen war. Mit der Ärztin führte ich ein Fließbandgespräch: Ich war sehr schnell wieder draußen, mit Tabletten im Gepäck. Fragen stellen oder Alternativen besprechen? Fehlanzeige!
Krebstherapie im Krankenhaus
Eine urologische Krebstherapie fand zunächst aus Kapazitätsgründen auf der HNO-Station statt. Dort gab es keinen zuständigen Arzt und somit auch keine Schmerzmedikamente nach der OP. Denn es musste ja erst der zuständige Arzt befragt werden.
Eine Chemotherapie war notwendig, die erfolgte auf der HNO-Station. Dort gab es eine Fachkraft, die sich um die Steuerung der Medikamentengabe kümmern durfte. Ewiges Warten war die Folge. Ich kann versichern: Patienten und ihre Angehörigen sind mit der Diagnose genug belastet. Wenn die Station keine Kapazitäten hat, kann sie keine Patienten aufnehmen. Aber die Kosten, die die Kassen für eine solche Behandlung zahlen, ist wohl zu attraktiv.
Chemotherapie am Vormittag des 26. Dezember. Der Patient möchte danach einfach nur nach Hause. Er muss sieben Tage später wiederkommen, sitzt im Rollstuhl und bedarf persönlicher Pflege. Ans Arbeiten ist in dieser Zeit nicht zu denken. Dennoch heißt es Warten auf dem Flur: Zwei Stunden, am zweiten Weihnachtsfeiertag, auf einen Arztbrief, ohne den keine Entlassung erfolgen könne. Der Hausarzt konnte den Brief nicht lesen, weil er zwischen Weihnachten und Neujahr im Urlaub war. Der Stellvertreter hatte den Patienten nicht einbestellt. Und auch sonst interessierte sich bis zum nächsten Termin am 2. Januar niemand dafür.
Nach Verkehrsunfall auf der Rettungsstelle
Ein junger Mann, 1.93 cm groß, wird nach einem Verkehrsunfall in die Rettungsstelle eingeliefert. Als ihn die Partnerin besucht, liegt er auf einer viel zu kleinen Trage, zugedeckt mit einem Tuch und seiner verstaubten, kaputten Jacke. Er trinkt einen Schluck, auch seine Hände sind durch den Sturz schmutzig. Er darf nicht aufstehen. Niemand bringt ihm Wasser, damit er seine Hände reinigen kann. Es bringt ihm auch niemand eine Decke. Dafür spricht die Ärztin von Lebensgefahr.
Diese ist wohl nicht so groß, dass eine Verlegung in ein Bett auf einer Station geboten wäre: Nach acht Stunden auf der viel zu kleinen Trage geht der junge Mann auf eigenen Wunsch nach Hause. Das Vertrauen in die Klinik ist weg. Glücklicherweise wird er wieder gesund.
Haben wir noch eine freie Arztwahl?
Die freie Arztwahl war einmal ein hohes Gut, in unserem Gesundheitssystem. Doch gibt es sie noch? Allenfalls auf dem Papier. Vielleicht gibt es auf der Internetseite von deinem Hausarzt auch den Hinweis, dass aus Kapazitätsgründen keine neuen Patienten aufgenommen werden können. In unserer Kleinstadt ist das auf mehreren Seiten der Fall. Wer nicht zugezogen und im Ort versorgt ist, hat häufig keine Chance, den Hausarzt zu wechseln. Auch dann nicht, wenn die Chemie nicht stimmt oder die Behandlung nicht zielführend ist. Wer zugezogen ist, hat Anspruch auf eine Aufnahme, wenn der bisherige Hausarzt nicht mehr erreichbar ist.
Bei Fachärzten gibt es schon gar keine freie Arztwahl. In unserer Stadt gibt es seit etwa 15 Jahren keinen Hautarzt mehr. Zuständig ist eine Praxis in Brandenburg an der Havel, weil die damalige Ärztin dorthin gewechselt ist. Die Entfernung beträgt etwa 40 Kilometer. Bei Hautärzten in Potsdam ist es sehr schwierig, einen Termin zu bekommen. Wer Glück hat, überhaupt angenommen zu werden, wartet Monate, bis er vorstellig werden kann.
Ein Ende dieser eingeschränkten Versorgung ist nicht in Sicht. Gesetzliche Versicherte Patienten dürfen derzeit nicht darauf hoffen, dass die Politik grundlegende Veränderungen vornimmt. Der laute Gesundheitsminister Lauterbach verschwand nach dem Ende der Corona-Pandemie in der Versenkung. In der neuen Legislatur ist bislang nur von einer weiteren Gebühr die Rede: Es handelt sich um ein Strafgeld für Patienten, die ihre Termine nicht absagen.
Die Sache mit den Terminen
Schauen wir in eine Kinderarztpraxis irgendwo im Land Brandenburg: Mit der Pensionierung von zwei Ärztinnen trat eine neue Generation an, die den gesamten Praxisbetrieb änderte. Das persönliche Telefongespräch ersetzte eine Telefonanlage. Die Praxis ist grundsätzlich verschlossen: Wer eingelassen werden möchte, muss an der Tür klingeln. Nur mit Termin erfolgt ein Einlass. Unbestellte und chronisch kranke Kinder warten zunächst auf dem Flur.
Die Sprechzeiten sind fest durchgetaktet. Während der Säuglingsssprechstunde gibt es keine Akutversorgung, es wird auf die Kindernotaufnahme im 20 Kilometer entfernten Krankenhaus verwiesen. Kinder, deren Eltern sich gegen die Impfung entscheiden, werden nur noch im Akutfall behandelt.
Wir bleiben im Land Brandenburg: Chronisch kranke Patienten sind offenbar zu teuer: Anders lässt sich das undurchdringliche System einer Allgemeinarztpraxis nicht erklären. Es gibt eine Online-Terminvereinbarung, die von chronisch Kranken nicht genutzt werden darf. Diese Patienten müssen anrufen oder den Termin persönlich vor Ort vereinbaren.
Auch die Ausgabe von Rezepten ist an ein System gebunden: Es gibt einen Anrufbeantworter, auf den die benötigten Medikamente aufgesprochen werden können. Die Vorlaufzeit für die Ausgabe des Rezepts beträgt zwei Wochen. Alternativ ist es möglich, persönlich vorbeizukommen und einen Zettel mit den benötigten Medikamenten einzureichen. Wartezeit: Mindestens eine Woche.
Vielleicht bin ich durch das „alte“ System zu verwöhnt. „Damals“ ging man zum Tresen und bekam ein Rezept sofort. Eine Arzthelferin ging ans Telefon, ich konnte persönlich mit ihr sprechen. Warum hat sich all dies geändert? Gibt es wirklich so wenige Ärzte, so wenige Schwestern, oder hat die Anzahl der Patienten so stark zugenommen?
Gebühr für nicht abgesagte Termine
Seit einigen Tagen ist eine neue Gebühr im Gespräch: Patienten sollen laut den Vorstellungen der kassenärztlichen Vereinigung bis zu 100 EUR zahlen, wenn sie einen Termin nicht rechtzeitig absagen. Mein erster Gedanke war: Das ist nicht schwer und absolut gerechtfertigt. Doch wenn wir hinter die Fassade schauen, ergibt sich ein anderes Bild.
Alle Mitarbeiter sind mit den kleinen Patienten beschäftigt
So lautet eine Bandansage der bereits erwähnten Kinderarztpraxis im Land Brandenburg. In den sozialen Netzwerken beschreiben viele Patienten, dass sie in ihrer Praxis niemanden erreichen. E-Mails werden nicht zeitnah gelesen.
Wenn diese Gebühr kommt, benötigen die Patienten ein rechtssicheres System, nach dem sie ihren Termin absagen können. Es kann nicht die Lösung sein, krank in die Praxis fahren zu müssen, um Bescheid zu sagen, dass der Termin wegen Krankheit nicht wahrgenommen werden kann.
Bekommen Patienten Geld für lange Wartezeiten?
Ein berechtigter Gegenvorschlag lautet: Patienten, die trotz eines Termins lange warten, sollen ebenfalls Anspruch auf eine Entschädigung haben. Dem stimme ich zu.
Mittlerweile (werden) zehn bis 20 Prozent der Termine nicht wahrgenommen.
Frank Gassen. Chef der Kassenärzte
Zu den zwei Stunden Wartezeit bei einem Facharzt, die ich weiter oben beschrieben habe, gesellt sich eine Stunde bei einem weiteren Arzt. Drei Stunden Lebenszeit in einer Woche. Nun stelle ich mir vor, die zehn oder 20 Prozent der Patienten, die nicht gekommen sind, würden auch noch im Wartezimmer sitzen. Wie viele Minuten – oder Stunden – hätte sich meine Wartezeit verändert?
Mir persönlich eröffnet sich das Bild, dass die Ärzte trotz der Absagen ausgelastet sind. Ist ein Verdienstausfall zu kompensieren, wenn das Wartezimmer voll und die Sprechzeit ausgelastet ist? Oder müssten die Wartezimmer nicht zeitweise leer sein, wenn die unentschuldigt fehlenden Patienten für „wirtschaftliche Schäden“ sorgen?
Ich hätte keine Ahnung und sollte mir das oder jenes Gesetz genauer anschauen. Das muss ich nun nicht, denn ich behaupte gar nicht, die gesetzlichen Grundlagen zu kennen. Ich meine nur, wenn Ärzte durch nicht abgesagte Termine Nachteile haben, müssten wir Patienten das doch bemerken: An bis zu 20 Prozent gähnender Leere, im Wartezimmer.
Lange Wartezeiten trotz eines Termins sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Eine einseitige Gebühr einzuführen, wäre ungerecht. Wenn Patienten entschädigen sollen, dann bitte auch die Ärzte. Oder gar keiner. Was am Besten wäre.
Ist es so schwer, einen Termin abzusagen?
Natürlich nicht. Oder doch? Es braucht ein funktionierendes Kommunikationssystem per Telefon, E-Mail oder App. Ist das nicht vorhanden, darf den Patienten kein Vorwurf gemacht werden.
Menschen aus bestimmten Kulturkreisen haben eine ganz geringe Termintreue, tauchen zwei Stunden zu spät auf, wollen dann behandelt werden … Das machen oft Menschen mit einer geringen Zuneigung zu Terminen und ausgedehnter Freizeit … Ich bin um 12 Uhr aufgewacht und habe festgestellt, ich hatte ja um 11 einen Termin.
Dr. Uwe Kraffel, Vorstand beim Deutschen Facharztverband
Bei den angesprochenen Menschen handelt es sich in der Regel um Patienten, die ihre medizinische Behandlung nicht selbst zahlen. Wer übernimmt die Strafgebühr? Der Steuerzahler?
Sanierung der Krankenkassen
Ist dieser Vorstoß neben all den weiteren Gebühren, die Patienten in den letzten 30 Jahren zahlen mussten, eine neue Einnahmequelle, die der Sanierung der Krankenkassen dienen soll? Es bleibt abzuwarten, wie die Diskussion ausgeht.
Rettung nicht in Sicht – ein Fazit
Eine Rettung ist für unser Gesundheitssystem derzeit nicht in Sicht. Für mich sieht es eher nach dem Gegenteil aus: Die Kosten werden steigen, die Qualität der Versorgung sinkt. Ich möchte betonen, dass Ärzte und Schwestern daran in den allermeisten Fällen keine Schuld haben. Die Politik krankt. Und das nicht nur in den Fragen des Gesundheitssystems.
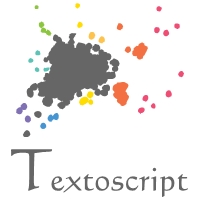
ISSN 3053-674X





